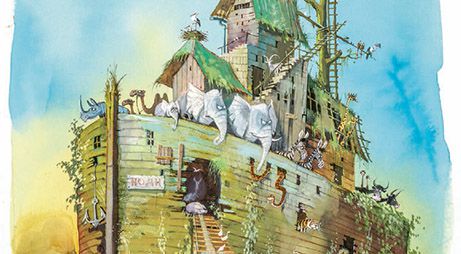Gefahr von Starkregen: Baugebiet Wetzendorf verstärkt Hochwasserrisiko
Offener Brief an den Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg
Pressemitteilung vom 10. September 2025
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
am 9. September 2025 erreichte ein heftiges Starkregenereignis den Rhein-Erft-Kreis – insbesondere Bedburg und Umgebung wurden massiv getroffen. Innerhalb weniger Stunden fielen Niederschläge, die weit über den Monatsdurchschnitt lagen – in Teilen bis zu 160 l/m2 waren registriert worden.
Im Ortsteil Kaster wurde ein Neubaugebiet, das als hochwassersicher gilt und auf Klimaresilienz ausgelegt wurde, überschwemmt. Bürgermeister Sascha Solbach äußerte, dass „das Prinzip Schwammstadt mit vielen Retentionsflächen und eigenem Regenrückhaltebecken“ eigentlich ausreichend sein sollte – doch diesmal reichte es nicht aus. Im betroffenen Neubaugebiet standen die Straßen und Grundstücke bis zu 60 cm unter Wasser.
Maßnahmen des Neubaugebiets (Schwammstadt-Konzept)
Die Stadt Bedburg hatte das Neubaugebiet mit den typischen Instrumenten moderner, klimaresilienter Stadtplanung ausgestattet:
- Regenrückhaltebecken, um überschüssiges Wasser lokal zu speichern
- Retentionsflächen, die als Pufferzonen für starke Niederschläge dienen
- Rigolen (versickerungsfähige Mulden oder Rinnen), um Wasser zu verzögern und ins Erdreich abfließen zu lassen
Diese Maßnahmen greifen das Konzept der Schwammstadt auf – durch Versickerung, Verdunstung und gezielte Speicherung wird versucht, Starkregen lokal möglichst schadlos zu bewältigen.
Warum waren die Maßnahmen nicht ausreichend
- Extrem hohe Niederschlagsmengen: Die lokal gemessenen Regenmengen waren extrem – zum Teil mehr Regen als normalerweise im gesamten September üblich. Damit wurden die Dimensionen, auf die Rückhaltebecken und Retentionsflächen ausgelegt waren, deutlich überschritten.
- Überlastung der Infrastruktur: Die vorhandenen Rückhalte- und Versickerungsmöglichkeiten konnten das Volumen nicht vollständig aufnehmen. Die Kanalnetze waren vermutlich ebenfalls überlastet – viele Schwammstadt-Komponenten wirken nur bis zu einer gewissen Belastungsgrenze.
- Flächenversickerung stoßartig überlastet: In extremen Situationen, wie diesem Starkregen, versagt oft die Annahme einer gleichmäßigen Versickerung – stattdessen entsteht oberflächennahe Überlastung, bei der Wasser sich in Geländesenken sammelt oder entsprechend dem Gefälle abfließt, ohne versickern zu können.
- Limits der Planung: In der Hochwasserrisiko-Managementplanung ist man in Bedburg beispielsweise für HQ100 („hundertjährliches Hochwasser“) abgesichert – aber bei Extremereignissen kann auch ein HQ100 überschritten werden.
In diesem konkreten Fall erweist sich:
- extrem hohe Niederschlagsmenge (bis 160 l/m2) => Schwammstadt-Maßnahmen überlastet
- Retentionsflächen und Beckenkapazität: klassische Rückhaltevolumen übertroffen
- Versickerungskapazität (Rigolen): lokal unzureichend bei sehr großem Zuwachs
- Planung nach HQ100-Extremereignis („Millionen-Jahres-Regen“) nicht abgedeckt
Trotz moderner, klimaresilienter Architektur reichte das Konzept des Neubaugebiets nicht aus, um die extremen Regenmengen schadlos aufzunehmen. Die Hochwasserschutzmaßnahmen funktionierten – aber nur bis zu ihren Auslegungsgrenzen. Diese wurden bei dem Ereignis am 9. September 2025 deutlich überschritten, was zur Überschwemmung führte.
Für den BUND Naturschutz in Nürnberg drängt sich der Vergleich mit dem geplanten Neubaugebiet in Wetzendorf geradezu auf: Das Gebiet liegt im Überschwemmungsbereich des Wetzendorfer Landgrabens, der die Hauptentwässerungslast des Gebiets zwischen Flughafen und Pegnitz in seinem Verlauf leisten muss.
Wir dürfen vor dem Hintergrund der aktuellen Lage in Bedburg an unsere im Bebauungsplanverfahren erhobenen Einwände erinnern:
Neue Bebauung würde den Retentionsraum verkleinern und den Abfluss verschlechtern – genau das, was § 78 WHG verhindern soll (Ausnahmen nur, wenn u. a. keine nachteilige Änderung von Wasserstand/Abfluss und voller funktions- und zeitgleicher Ausgleich des Rückhalteraums gelingt – bei einem Neubaugebiet praktisch nicht erfüllbar).
Die EU-Hochwasserrisikorichtlinie verlangt, hochwasserbedingte nachteilige Folgen zu verringern – zusätzliche Siedlungsflächen im HQ100-Gebiet laufen dem zuwider.
Eingriffe in Aue/Gewässerbett bergen das Risiko einer Verschlechterung des Gewässerzustands (WRRL Art. 4). Nach dem EuGH-„Weser“-Urteil ist jede relevante Verschlechterung unzulässig; Projekte müssten dann versagt werden.
Auenflächen sind Retentionsräume, filtern Nähr- und Schadstoffe, speichern/versickern Wasser und kühlen/befeuchten die Landschaft. Versiegelung und Verbau zerstören diese Funktionen und schwächen Klima- und Starkregenvorsorge.
Der Wetzendorfer Landgraben weist eine hohe Artenvielfalt auf (über 300 Pflanzenarten, mehr als 20 Rote-Liste-Arten im Untersuchungsgebiet), kartiertes Bodenbrütergebiet z.B. des Kiebitz. Bebauung würde Lebensräume und Biotopverbund entlang des Gewässers erheblich beeinträchtigen.
Bauleitplanung muss Klimaschutz und Klimaanpassung berücksichtigen (§ 1a Abs. 5 BauGB) – der Erhalt/die Aufwertung der Aue ist hier die naturbasierte, risikoarme Option, nicht die Neuversiegelung in der Überflutungsfläche.
Wegen klarer Verbote/Restriktionen im Überschwemmungsgebiet, des WRRL-Verschlechterungsverbots und der erheblichen ökologischen Funktionen/Artenwerte ist die Ausweisung eines neuen Baugebiets an dieser Stelle rechtlich hoch problematisch und fachlich nicht vertretbar.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir bitten Sie, ganz konkret klären zu lassen, welche Konsequenzen sich aus dem Hochwasser im Neubaugebiet Kaster in der Stadt Bedburg für das geplante Neubaugebiet in Wetzendorf ergeben, und sind für eine schriftliche Antwort dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Klaus-Peter Murawski, Staatsminister a.D.
1. Vorsitzender Kreisgruppe Nürnberg BUND Naturschutz in Bayern e.V.